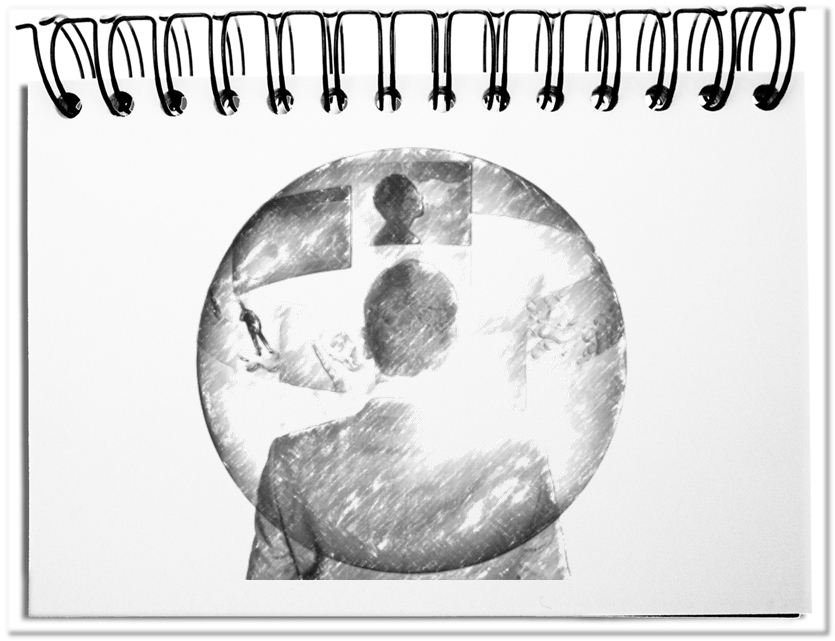Wir lernen durch Beobachtung von Lehrern oder anderen und aus den Erfahrungen, die wir selbst machen. Dabei spielt sich alles in unseren Köpfen ab – in jedem Einzelnen. Die Lektionen werden durch mündliche Weitergabe und entsprechende Trägermedien übermittelt – z.B. Werkzeuge, Instrumente, Skulpturen, Visualisierungen und multimediale Medien. Wenn Zeitzeugen fehlen, werden vergangene Erfahrungen nur durch Objekte sichtbar. Aus historischen Funden leiten wir die Erkenntnisse früherer Menschen ab. Mündliche Überlieferungen wie die der Aborigines, die Ereignisse und Erfahrungen der Vergangenheit seit undenklichen Zeiten von Generation zu Generation weitergeben, sehen klassische Medien nicht als bestätigte Nachweise. Deshalb akzeptieren beispielsweise die Regeln von Wikipedia keine Beiträge, die Mund zu Mund überliefert sind. Damit liegt ein großer Teil unseres Wissens im Dunkeln des Undokumentierten. Das vorzeigbare Know-how ist beschränkt auf die gefundenen Artefakte – Faustkeile von vor 1,75 Millionen Jahren; über 40.000 Jahre alte Flöten; Höhlenmalereien und Skulpturen, die über 30.000 Jahre alt sind. Bei aller Körperlichkeit der Objekte bleiben uns die Bedeutung und die damit verbundenen Gedanken und Fähigkeiten unerreichbar.
Durch entsprechende Auslegung können Erkenntnisse, wie z.B. das Wissen über vergessene medizinische Wirkstoffe wieder zum Leben erweckt werden. Eine entscheidende Rolle bei der Wiederverwendung spielen die Sprache, das Übertragungsmedium und der Kontext. Diese Aspekte gelten auch für die Flut an begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen (mehr als 2,5 Mio. Artikel in 2018). Was sollten wir bedenken, wenn wir aus früheren Erfahrungen lernen wollen?
- Die Sprache offenbart – wenn auch nicht alles
Wir leben mit der Illusion, dass Überzeugungen nachvollziehbar in eine sprachliche Form gebracht werden können. Dabei übersehen wir, dass die Formate des Ausdrucks nicht in der Lage sind, die tatsächliche Bedeutung vollständig zu transportieren (s. Meta-Modell der Sprache). Das gilt vor allem für die genutzten Zeichen und Worte und das abweichende Vokabular von Sprachen (Fachjargons und Übersetzungen) – wenn beispielsweise das Verständnis von kurz-, mittel- und langfristig von einem bis zehn Jahre auf einen Monat bis drei Jahre verkürzt wird, hat dies unterschiedliche Auswirkungen. Im ersten Fall kann die Zukunft gemeinsam gestaltet werden. Im zweiten Fall läuft die Belegschaft immer neuen Vorgaben hinterher, ohne eine Chance zu haben, sich zu beteiligen.
Historische Aussagen können wir nur durch Annahmen nutzen. Obwohl wir die Zeichenfolge eines Wortes lesen können, wissen wir nicht, was sie ursächlich bedeuteten. Die alten Griechen unterschieden projekthafte Geschäftstätigkeit zum Erwerb des Lebensunterhaltes und der Finanzierung der Muße von der körperlichen Sklavenarbeit. Das entspricht nicht mehr unserer heutigen Sicht, bei der die Work-Life-Balance im Vordergrund steht. Der Anreiz zu arbeiten (Work) ergibt sich heute intrinsisch aus dem Verlangen nach Anerkennung und Selbstbestätigung sowie extrinsisch aus pekuniären und anderen geldwerten Leistungen. Der Drang nach Work-Life-Balance ist der Versuch die Belastungen der Tätigkeit durch Freizeitaktivitäten (Life) auszugleichen, nicht Muße. Die Unannehmlichkeiten der Arbeit, die Abhängigkeiten, Fremdbestimmungen und Entmündigungen sollen in der Freizeit diese Nachteile durch einen übervollen Kalender von Freizeitaktivitäten ausgleichen.
Die Begrifflichkeiten der Arbeit und Nicht-Arbeit haben sich über die Jahrhunderte immer wieder verschoben – selbst bei der Agilisierung der letzten Jahre. Trotzdem halten Unternehmen weiter an vertikaler und horizontaler Arbeitsteilung fest. Mit ihren veralteten Vorgehen scheitern Unternehmen bei der Einführung neuer Führungsstile für die agile VUKA-Welt. - Das Medium überträgt – wenn auch nicht für immer
Die Langlebigkeit und die Verfügbarkeit eines Mediums legen fest, ob Auffassungen sichtbar bleiben. Höhlenwände, die unzugänglich und vor Licht geschützt trocken liegen, haben Zeichen und Bilder über vierzigtausend Jahre erhalten – Keramiktafeln überdauern 5000 Jahre; Bücher und Handschriften erleben mehrere Jahrhunderte; Filme lösen sich nach 40 bis 150 Jahren auf. So wie die meisten Artefakte aus der Vergangenheit verschwunden sind, werden unsere heutigen Medien sich auflösen – optische Speichermedien halten fünf, 100 und in professionellen Fällen 1000 Jahre; Festplatten und Flash-Speicherüberstehen bis zu zehn Jahre. In Ermangelung von mündlicher Überlieferung verschwand durch die geringe Haltbarkeit der Medien der größte Teil der Erfahrungen. Selbst wenn sie lange Zeit überstehen, müssen sie erst mal gefunden werden und lesbar sein. Erinnern wir uns an die Schriftrollen vom Toten Meer, die nach fast zweitausend Jahren entdeckt wurden.
Zum besseren Verständnis fehlen dann noch die undokumentierten Puzzlesteine – die Erfahrungen, die nicht aufgezeichnet wurden, und das fehlende Verständnis des Entstehungskontexts.
Handbücher liefern allgemeine Grundlagen, aber es würde deren Rahmen sprengen, wenn das Umfeld beschrieben wäre. Damit ist der Einsatz bei den sich wandelnden Aufgaben eine Transferleistung, die nur mit viel Aufwand möglich ist. Ein Beispiel ist das aufwendige BPM der Achtziger, das nicht mehr zu den jetzigen, sich schnell ändernden Tätigkeiten passt. - Der Kontext unterstützt – wenn auch nicht überall
Die Erfahrungen entstehen stets in einem bestimmten Umfeld. Das Verständnis der Begleitumstände setzen die Autoren stets voraus. In der Folge vergessen sie wesentliche Erläuterungen des Zusammenhangs. Dadurch bleiben die ausgearbeiteten Eindrücke missverständlich. Betrachten wir die Herrschaft des Volkes, die Demokratie, d.h. die Beteiligung der Bevölkerung an politischen Beschlüssen. Im antiken Griechenland waren nur sogenannte Vollbürger, 10-20% der Bürger (i.e. Athener, die kämpfen konnten, allerdings keine Frauen, Sklaven oder Fremde) an Entscheidungen beteiligt. Wir verstehen unter Demokratie heute Mitbestimmung der gesamten Bevölkerung, Gleichberechtigung, Mehrheitsentscheidungen usw. – zumindest prinzipiell.
Der Kontext setzt sich aus unterschiedlichen Reichweiten (lokal, regional, kontinental und global) zusammen. Die sich ergebende Mischung ist nur schwer greifbar – der berlinerische Charlottenburger unterscheidet sich von dem italienischen Schwabinger und gleichzeitig teilen sie miteinander die deutsche Mentalität.
Die entsprechenden Zusammenhänge werden nicht mitgeliefert und gehen mit der Zeit verloren. Heute versuchen wir mit Kulturstudien diesen Kontext herzustellen, was sehr schwer ist, da diese Inhalte selten beschrieben sind und Zeitgenossen nicht mehr gefragt werden können. Denken wir an die Gestaltung der Abläufe nach den Prinzipien des Taylorismus: es gibt einen, besten Weg; Ort und Zeit stehen fest; fein gegliederte Aufgaben werden angestrebt; Einwegkommunikation; kleingliedrige Zielvorgaben ohne Bezug auf Unternehmensziele; Qualitätssicherung von Dritten. In der schnelllebigen Welt von VUKA lassen sich diese Ansprüche aufgrund der latenzfreien Reaktionszeit nicht mehr verwirklichen.
Fazit: Aufgrund der Beschränkungen der Sprache, den selten verfügbaren und schwer verständlichen Nachweisen sowie dem fehlenden Kontext können frühere Erfahrungen nur mit großen Anstrengungen wiederverwendet werden. Meistens werden frühere Erfahrungen genutzt, um durch den Autoritätsbias die Zielgruppe zur Zustimmung zu bewegen (i.e. die Tendenz der Aussage einer Autorität zuzustimmen, unabhängig von ihrem Inhalt, obwohl man eine andere Meinung hat). Schon Goethe proklamierte im Faust „Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.“. Mit der Flut an Quellen, Erfahrungen und Fake News gibt es zu viele Ansätze, dass eine sachliche Wahl des „richtigen“ Ansatzes unmöglich wird. Aus diesem Grund müssen wir unsere eigenen Erfahrungen machen – uns irren, Fehler aushalten und es noch mal versuchen, bis es funktioniert.